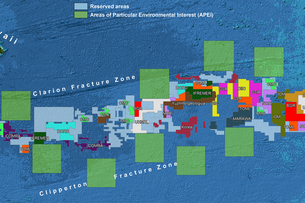ESSENS ENDE
Pascal Bovée
by
Pascal Bovée
Themes
Residencies
»Wat suchste?« Ein Mann in einem verwaschenen Metal-T-Shirt schaut mir über die Schulter. Er blickt in den Stadtplan, den ich aufgefaltet habe. Ich habe ihn nicht bemerkt, er muss vom Kiosk rübergekommen sein. »Entschuldige, ich bin betrunken. Aber wenn du Hilfe brauchst – ich kenn mich hier aus.«
Ich zeige ihm die Stelle auf dem Stadtplan, die ich suche.
»Da ist nichts«, sagt er kopfschüttelnd. »Nur Pampa.«
»Ja«, sage ich. »Da will ich hin. Ich möchte wissen, wo Essen endet.«
Er lässt sich auf die blaue Gitterbank am Wartehäuschen sinken. Ich sehe mich um. Gegenüber der Endhaltestelle ist eine Zoohandlung mit Kaninchen im Schaufenster. Aus der Altbaufassade des Hauses schauen goldene Porträtgesichter von Kaufleuten zu, wie zwei Autos in niedrigem Gang und mit hoher Geschwindigkeit durch die enge Straße jagen. Geradeaus steht ein betonierter Wohnkomplex, daneben der Kiosk. An einem roten Stehtisch trinken zwei Männer um die 50 ihr Bier.
»Scheiße hier, wa?«, fragt der Mann. Ich frage mich, ob sein Gesicht von der Sonne so rot ist. »Deswegen bin ich auch so besoffen«, schiebt er hinterher. Und scheint zu überlegen. Seine Stirn schlägt rote Wellen. Nach einigen Sekunden glätten sie sich wieder. »Naja, auch nicht beschissener als woanders«, resümiert er. Er lacht und ich lächle verlegen zurück, falte den Stadtplan zusammen. Wir schweigen eine Weile, dann zieht er etwas aus seiner Hosentasche. Ein blaues Tütchen.
»Willste? Schenk ich dir.« Während ich das Tütchen betrachte, schimpft er. »Kommt die 107 nie mehr?«
So ein Tütchen hatte ich lange nicht in der Hand. Ein Außerirdischer ist darauf abgebildet, grün und mit Antennen. Es ist eine Packung Magic Gum, dieses rosa Zeug, das auf der Zunge knistert.
»Muss man mit Bier gurgeln.«
Ich nicke. »Danke.«
»Ich würd ja noch eins zusammen trinken, aber... gleich hab ich Schicht.« Der Mann bindet sich die langen, grauen Haare mit einem Gummiband wie von einem Einweckglas zu einem Zopf und beginnt, mir von der Arbeit zu erzählen. Hauptsache, man habe welche, sagt er und deutet mit dem Kinn auf die beiden Männer am Stehtisch. Dass ich das jetzt nicht falsch verstünde. Normalerweise trinke er nämlich nichts, wenn er arbeiten müsse. Das sei heute eine Ausnahme. »Weil Wochenende ist.« Wir schweigen noch einmal eine Weile und dann kommt doch noch eine Bahn. Er steht auf und verabschiedet sich mit einem Händedruck.
»Die fährt nach Gelsenkirchen«, sage ich. »Sie müssen doch Richtung Innenstadt, oder?«
Er nickt. Dann zuckt er die Schultern und steigt ein.
Eine Weile stehe ich noch an der Endhaltestelle und denke nach. Essen oder Gelsenkirchen, ist ihm das egal? Und mir? Weshalb suche ich hier nach der Stadtgrenze? Seit einer Woche tue ich das jetzt. Wahrscheinlich ist es nur ein Tick. Einmal habe ich mit einer Kollegin darüber gesprochen. Wir fuhren mit derselben Straßenbahn, von Gelsenkirchen nach Katernberg, schauten aus dem Fenster und fragten uns, ob wir gerade schon in Essen waren. Und woran man das eigentlich erkennen würde. Vorher hatten wir in Städten mit mittelalterlichem Kern gelebt. Die Ringe, die sich um eine historische Altstadt zogen waren deutlich erkennbar, eine ehemalige Stadtmauer, dann ein Autoring, dahinter die Neubauviertel und dann – ganz lange Nichts. »Dieses Nichts fehlt mir in Essen manchmal«, sagte ich. Sie nickte.
Und so habe ich einige Zeit später mit meiner Aktion begonnen: Mit den Straßenbahnen, den U-Bahnen und Buslinien fahre ich jetzt immer bis zur Endstation, weil ich die Stadtgrenze finden will. »Ich suche nach Essens Ende«, habe ich meiner Kollegin erklärt. Sie runzelte darüber die Stirn. »Ich glaube, du steigerst dich da in was hinein. Muss man unbedingt Grenzen ziehen, wo keine sind?«
Guter Einwand. Aber sind denn die Grenzen wirklich nicht da? Und suche ich überhaupt nach Grenzen oder nur nach einem Ende? Oder läuft das auf dasselbe hinaus? Ich recherchiere zum Thema Grenzen und finde vor allem nationale. Zäune und Mauern zwischen Staaten, die inzwischen wieder Konjunktur zu haben scheinen. Vom Mauerfall 1989 bis heute, erfahre ich aus einerm ARTE-Beitrag, habe sich die Anzahl der Grenzmauern verfünffacht. Aber das sind ja nicht diesselben Grenzen, nach denen ich in der Straßenbahn suche, oder?
Wieder sitze ich in der Bahn und denke nach. Wobei hilft es, wenn Dinge – Städte – an einem Punkt oder einer Linie enden? Lässt der Kopf da den Schlagbaum fallen? Das Konzept macht mich skeptisch. Trotzdem suche ich weiter. Es geht ja um etwas ganz Konkretes. Ich frage mich einfach: Warum endet die Straßenbahn ausgerechnet hier – zum Beispiel in Borbeck am Germaniaplatz, wenn die Stadt an dieser Stelle doch noch weiterzugehen scheint? Also fahre ich dorthin.
Zwei Mädchen um die zwölf, beide in weißen Leggins und T-Shirts mit Glitzeraufdruck, posieren vor der Germania-Statue. »Los, wer am scheißesten aussieht!«, sagt die eine und wirft die Haare zurück. Ich stehe auf der anderen Seite des Denkmals, schaue mir das Hinweisschild an und lese es laut vor: »Das Aussehen der Germania hat in den letzten 125 Jahren gelitten.« Die beiden Teenies nehmen die Nationalgöttin mit ins Bild. Scheiße aussehen mit Germania. Ein Foto-Shooting, das mir besser gefällt als das im April, wenn die Schützenvereine hier zum Germania-Fest Kränze niederlegen. Seit 1880 erinnert man offenbar so an den deutsch-dänischen und deutsch-französischen Krieg und ihre Gefallenen.
»Suchen Sie was Bestimmtes?«, fragt mich eins der Mädchen, als ich auf mein Handy schaue, um mich zu orientieren.
»Ja.«, sage ich. »Das Ende.«
»Von was?«
»Von Essen.«
Sie schütteln die Köpfe. Eine der beiden lacht laut auf und sagt mir, wo ich suchen soll. »Da hinter der Fahrschule um die Ecke.« Sie zeigt auf eine kleine Gasse. »Da gibt es jemanden, den können Sie das fragen.«
Ich gehe um die Ecke und stehe vor einem Gebäude aus gelbem und rotem Klinker. An die Dionysiuskirche hat der katholische Bergmannsverein eine kleine Grotte angebaut. Darin grüßt mich die Schutzpatronin der Bergleute mit betenden Händen. Vor der Kirchenmauer nebenan parkt ein Dodge-Transporter in Bronze. Auf der Rückseite der Aufkleber: »Stell dir vor du betest und Gott antwortet.« Auf die Frage nach dem Ende? Vielleicht. Aber das ist wieder nicht das Ende, das ich meine. Ich fahre zurück.
Am nächsten Morgen in der 108 können zwei Jungs gar nicht aufhören zu kichern, weil sie mit einer App heimlich Furzgeräusche machen. Nachdem sie aufs Handy gedrückt haben, wechseln sie immer schnell den Platz. Erst an der letzten Haltestelle steigen sie mit mir zusammen aus und gehen eine Treppe hinauf zu S-Bahn. Weil ich noch nicht genau weiß, wo ich hier suchen soll, folge ich ihnen erstmal. Vom Bahnsteig, der einige Meter oberhalb von Altenessen liegt, sehe ich Zahnlücken im Zaun, der den Schall der Güterzüge dämmen soll, die das Gleis mitbenutzen. Auf einem noch stehenden Zaunelement zwinkert mir Popeye zu. Der Seemann ist viel herumgekommen, aber nach dem Ende von Essen kann ich ihn nicht fragen – er ist nur ein Graffiti.
Ich verlasse den S-Bahnsteig und sehe mich im Stadtteil um.
»Ey, Spion«, ruft ein Mann von oben, als ich die leer stehende Bäckerei unter seinem Balkon fotografiere. »Wat suchste?«
Diesmal sage ich es lieber nicht. Ich grüße mit einem Winken und gehe schnell weiter. Vom Balkon höre ich, wie Musik lauter gedreht wird. Der Text ist gerappt und klingt metallisch, wie Schimpfen. Ich verstehe, dass meine Suche nach Essens Ende gerade hier unter seinem Balkon unhöflich wirken kann und verschwinde lieber in einem Getränkemarkt. Eher ziellos streife ich zwischen Bierkästentürmen herum. Was mache ich hier? Dann plötzlich stehe ich vor Jürgen Klopp. Ich erstarre. Wenn man Jürgen Klopp beim Getränkehändler in Altenessen trifft, soll man mit ihm einen Plausch halten? Zum letzten Titel gratulieren? Oder lieber so tun, als habe man ihn nicht erkannt? Jetzt ergreift er selbst das Wort. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?« Das klingt gar nicht nach Jürgen Klopp. Er ist es natürlich auch nicht, sondern der Getränkehändler, der ein Stück hinter dem Pappaufsteller des Trainers neue Kisten verräumt. Ich kaufe bei ihm eine Flasche Stauder. Mit Alkohol, auch wenn der Papp-Klopp mir lieber Alkoholfreies verkaufen möchte. Draußen stehe ich vor einer gelben Tonne, möchte das Bier aufmachen und den Kronkorken dort hineinwerfen, als ich es mir wieder anders überlege. Denn hinter der Tonne versteckt sich ein Rapper. Er heißt Babo, breakdancet auf dem Kopf und reimt auf das Ende: »Das ist die Fremde, die Biege, die Wende, solltest du machen, bevor ich dich kenne, wiedererkenne, die Augen, die Haare, die zitternden Hände, pass auf, denn ich wende dir deine Wände, die Decke zum Boden, die Mauern zu Steinen, die Grenze, die ich dir entwende, verschwende hier deine Zeit nicht, los, gib mir dein Handy, du brauchst keine Technik, Zen liebt dich, wohin ich dich sende, in Frieden nach Süden, zum Ende.«
In Bredeney, am anderen Ende der 108, sehe ich Flugzeuge über mir queren. Die Straßenbahnen machen hier eine Schleife um einen großen Platz, der eher ein Park ist. Mit ihren Rädern zerquetschen sie die Maronen, die in die Schienen geraten sind. Alte Frauen mit großen Plastiktüten sammeln die Esskastanien auf. Ein Folkwangstudent, der weiter nach Werden will, nutzt die Wartezeit für Tanzübungen. Auf dem Grün unter den Bäumen sehen sie aus wie Kampfsport. Schattenboxen gegen die Bahnen. Zen? Dann ist das Ende gar nicht das Ende, denke ich. Es ist der Anfang. Ich reiße das blaue Tütchen mit dem Außerirdischen auf und kippe mir die Magic Gums in den Mund. Es beginnt zu knistern, zuerst auf der Zunge, dann die ganze Mundhöhle. Sogar im Gehirn beginnt es zu knistern. Mit dem Bier aus dem Getränkehandel lösche ich ab.